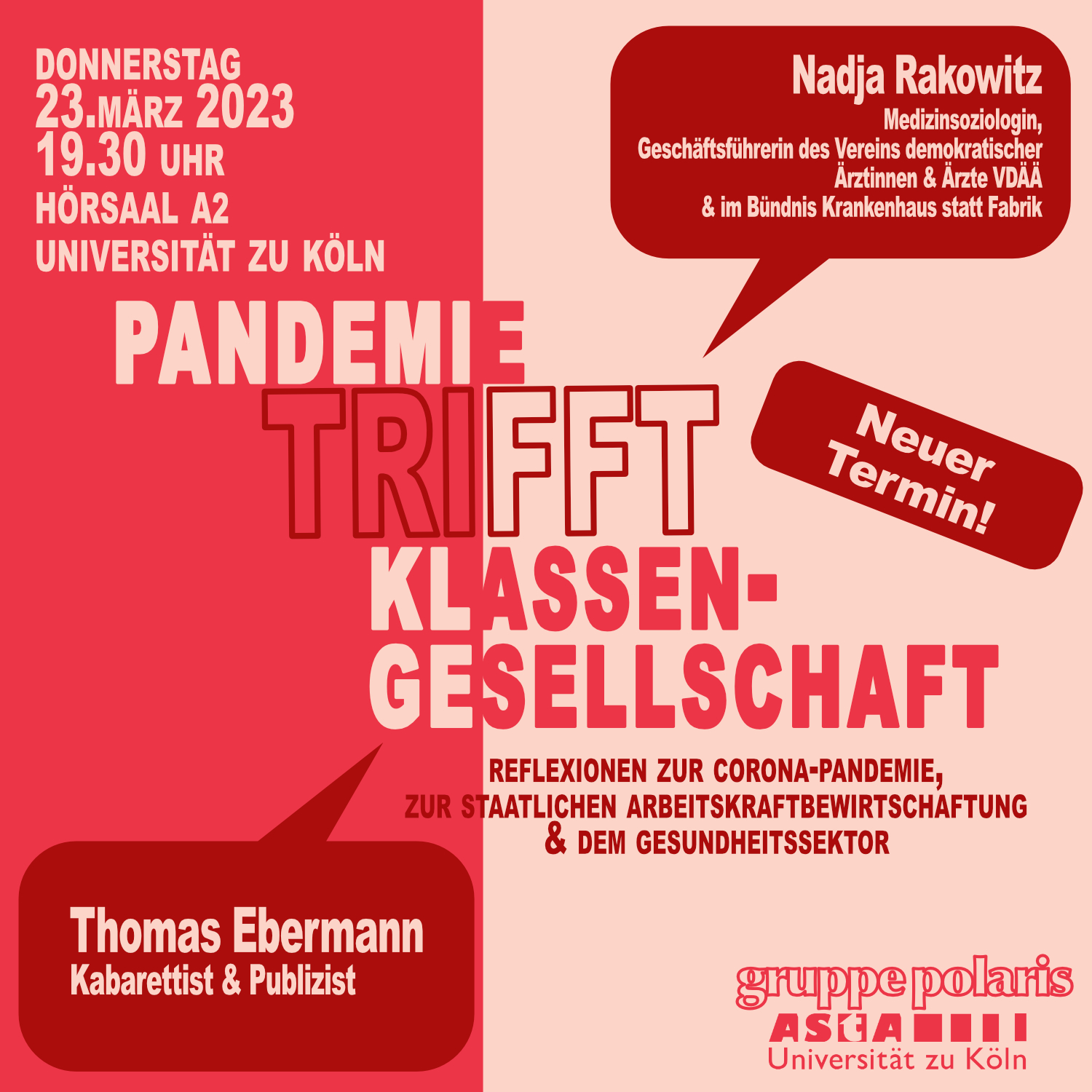Podcast: Download (Duration: 44:10 — 45.6MB)
von Mr Pinguin, Sippurim und sonja
Wie kann eine Kritik des autoritären Liberalismus aussehen? Wie können wir den Techniken der Individualisierung, Entpolitisierung und Entsolidarisierung entkommen, die lange schon den Spätkapitalismus prägen und in der Corona-Krise manche Leben prekärer machen als andere? Was kann der »Biopolitik von oben« entgegensetzt werden, die wir im ersten Teil dieses Podcasts diskutiert haben?
Ausgehend von einer Analyse der Geschichte neoliberaler Selbstführung und ihren verschärften Effekten unter den Bedingungen der Corona-Pandemie und ihrer Regierungstechniken, fragt dieser Beitrag nach einer anderen Biopolitik, einer »Biopolitik von unten«. Seit der zweiten Frauenbewegung und der Schwarzen Bürger*inrechtsbewegung sind Widerstandsmomente gegen liberale Gesundheitspolitiken tradiert, die Ansätze einer radikalen Politik der Sorge entwerfen, wie sie etwa schon in den sozialen Kämpfen während der AIDS-Epidemie mobilisiert worden sind. Queere, feministische und rassismuskritische Bewegungs- wie Theoriearchive bilden neue Politiken der Subjektivierung und der Solidarisierung, die von der Verflochtenheit spätkapitalistischer Leben in rassistische, heteronormative und sexistische Machtverhältnisse ausgehen.
Weiterlesen